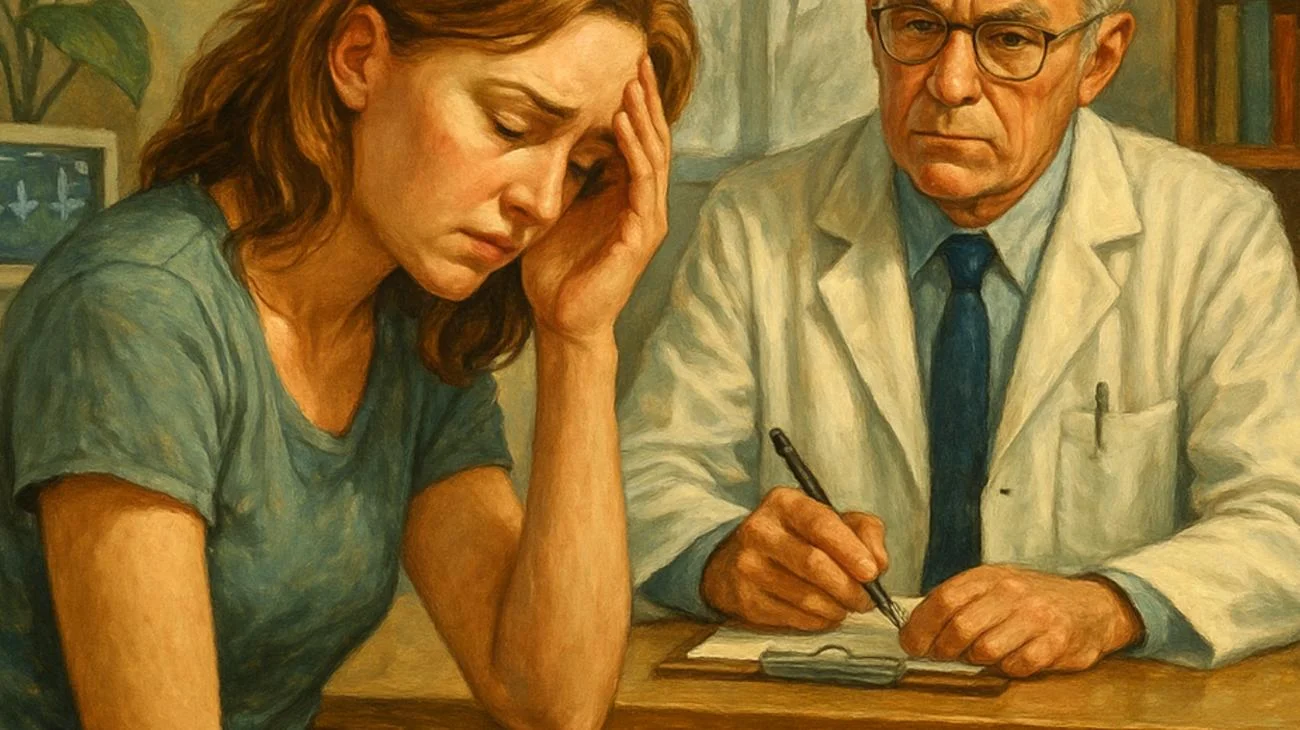Wenn dein Gehirn das eine sagt, der Arzt aber was anderes hört: Diese 5 psychischen Störungen werden am häufigsten falsch eingeschätzt
Du schleppst dich seit Monaten durch den Tag, fühlst dich wie ein ausgewrungener Schwamm, und irgendwann raffst du dich auf und gehst zum Arzt. Der schaut dich an, nickt weise und sagt: „Depression. Hier, nehmen Sie das.“ Drei Monate und eine Medikamentenschachtel später bist du immer noch fertig, nur jetzt auch frustriert. Warum? Weil du vielleicht gar keine Depression hast. Oder nicht nur. Oder eine ganz andere Form davon. Welcome to the Jungle der psychischen Fehldiagnosen.
Das deutsche Gesundheitssystem ist eigentlich ziemlich gut darin, psychische Probleme zu erkennen. Im Jahr 2024 bekamen satte 40,9 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Diagnose aus dem Bereich psychische Störungen. Das klingt erstmal nach guter Versorgung. Aber Experten warnen: Hinter diesen Zahlen versteckt sich auch ein massives Problem. Manche Störungen werden nämlich wie Popcorn verteilt, während andere jahrelang im Schatten bleiben und fröhlich vor sich hin wüten.
Bevor wir loslegen: Es gibt keine offizielle Hitparade der „Top 5 am meisten verkackten Diagnosen“. Was es aber gibt, sind bestimmte Störungsbilder, bei denen Fachleute immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie so oft übersehen, verwechselt oder einfach falsch etikettiert werden. Die folgende Liste basiert auf echten Versorgungsdaten aus Deutschland und dem, was in der klinischen Praxis tatsächlich schiefläuft.
Depression vs. das ganze restliche Leben (Stress, Burnout, kaputte Schilddrüse)
Depressionen gehören zu den absoluten Spitzenreitern unter den psychischen Diagnosen und sind einer der häufigsten Gründe, warum Leute krankgeschrieben werden. Das Problem: Die Symptome sind so verdammt allgemein, dass sie auf etwa zwölf verschiedene Dinge gleichzeitig passen könnten.
Müde? Check. Schlecht geschlafen? Check. Keine Lust auf irgendwas? Check. Konzentration im Eimer? Check. Gratulation, das könnte eine Depression sein. Oder du hast drei Monate im absoluten Jobwahnsinn hinter dir. Oder deine Schilddrüse spinnt. Oder du hast einen Vitamin-D-Mangel, der sich gewaschen hat. Oder einen Eisenmangel. Oder alles zusammen, weil das Leben manchmal ein Arschloch ist.
In der Praxis passieren dann zwei Dinge gleichzeitig: Menschen mit echter klinischer Depression werden abgewimmelt mit „Ach, das ist halt stressig gerade, mach mal Yoga“. Und andere kriegen die volle Depression-Diagnose mit Medikamenten und allem Drum und Dran, obwohl eigentlich ihre Schilddrüse schuld ist. Besonders perfide wird es, wenn körperliche und psychische Faktoren sich gegenseitig hochschaukeln – dann ist die Frage nach Henne und Ei ungefähr so klar wie Schlamm.
Der entscheidende Punkt: Eine echte Depression ist nicht einfach „mal schlecht drauf sein“. Sie hält über Wochen an, macht dein Leben zur Hölle und lässt sich nicht mit ein bisschen positivem Denken wegzaubern. Aber ohne gründliche Abklärung – und damit ist auch körperliche Abklärung gemeint – kann selbst die beste Therapie ins Leere laufen.
Woran du merkst, dass was nicht stimmt
Wenn die Behandlung nach Monaten null Wirkung zeigt, sollten bei dir und deinem Arzt die Alarmglocken läuten. Vor allem, wenn niemand jemals deine Schilddrüsenwerte, Eisenwerte oder Vitamine gecheckt hat. Eine Depression ohne körperliche Basisabklärung zu diagnostizieren ist ungefähr so schlau, wie ein Auto zu reparieren, ohne unter die Motorhaube zu schauen.
Bipolare Störung: Die Meisterin der Verkleidung
Hier wird es richtig fies. Bipolare Störungen sind die absoluten Ninjas unter den psychischen Störungen. Viele Betroffene landen jahrelang mit der Diagnose „Depression“ in der Behandlung, weil genau das der Teil ist, der sie zum Arzt bringt. Wenn es dir beschissen geht, gehst du zum Arzt. Wenn du dich fantastisch fühlst, zehn Projekte gleichzeitig startest und drei Nächte durcharbeitest, denkst du: „Geil, läuft!“
Das Problem: Diese „guten Phasen“ können hypomanische oder manische Episoden sein. Die gehören zur bipolaren Störung wie Batman zu Gotham. Aber wenn sie mild ausfallen, werden sie als „kreative Phase“ oder „endlich mal motiviert“ abgetan. Erst wenn jemand in der Manie sein ganzes Konto leerräumt, um ein Alpaka-Zucht-Startup in Peru zu finanzieren, wird es offensichtlich. Bis dahin können Jahre vergehen.
Die Zahlen zeigen, dass depressive Störungen megahäufig diagnostiziert werden. Wie viele davon eigentlich unerkannte bipolare Störungen sind, weiß niemand so genau. Aber Fachleute berichten regelmäßig von dieser diagnostischen Falle. Und das ist mehr als nur theoretisches Gefasel: Die Behandlung ist komplett unterschiedlich. Antidepressiva ohne Stimmungsstabilisierer können bei bipolaren Störungen im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv sein und die Stimmungsschwankungen noch verstärken.
Der Knackpunkt für Betroffene
Wenn du jemals Phasen hattest, in denen du deutlich weniger Schlaf gebraucht hast, ungewöhnlich redselig warst, tausend Ideen gleichzeitig hattest oder Dinge angefangen hast, die du nie beendet hast – und das im Wechsel mit depressiven Phasen –, dann sag das verdammt nochmal deinem Arzt. Die können nicht hellsehen. Wenn du nur in den Tälern in der Praxis sitzt und die Gipfel für dich behältst, fehlt die Hälfte des Puzzles.
ADHS bei Erwachsenen: „Du bist nicht chaotisch, du bist faul!“
„Streng dich einfach mehr an.“ „Wenn es dir wichtig wäre, würdest du es nicht vergessen.“ „Jeder prokrastiniert mal.“ Falls diese Sätze der Soundtrack deines Lebens sind – von Eltern, Lehrern, Chefs und vor allem von dir selbst –, dann haben wir hier vielleicht eine der hartnäckigsten Nicht-Diagnosen überhaupt.
ADHS bei Erwachsenen wurde jahrzehntelang massiv unterdiagnostiziert, weil alle dachten, dass man da einfach rauswächst. Spoiler: Tut man nicht. Die Symptome ändern sich nur. Aus dem zappeligen Kind, das nicht stillsitzen kann, wird der Erwachsene, der innerlich permanent auf 180 ist, ständig drei Sachen gleichzeitig anfängt, chronisch zu spät kommt und wichtige Deadlines bis zur letzten Sekunde ignoriert. Nicht weil du faul bist oder es dir egal ist, sondern weil dein Gehirn bei der Selbstregulation einfach nicht mitspielt.
Das Gemeine an ADHS: Die Symptome überlappen sich mit etwa jedem zweiten psychischen Problem. Konzentrationsprobleme? Könnte auch Depression sein. Impulsivität? Vielleicht eine Persönlichkeitsstörung. Vergesslichkeit und Chaos? Vielleicht einfach ein unorganisierter Mensch. Diese Überlappungen sorgen dafür, dass ADHS entweder komplett übersehen oder mit allem Möglichen verwechselt wird.
Besonders perfide ist es bei Frauen. Bei denen tritt ADHS häufiger in der „unaufmerksamen“ Variante auf – ohne die klassische Zappeligkeit. Ergebnis: Jahrelang wird an Depression, Angststörungen oder „mangelndem Selbstwertgefühl“ herumgedoktert, während die neurobiologische Grundlage unbehandelt bleibt. Es ist, als würde man versuchen, einen platten Reifen mit Lufterfrischer zu reparieren.
Was du tun kannst
Führe ein Symptomtagebuch. Notiere nicht nur, was schiefläuft, sondern auch Muster: Wann klappt Konzentration? Wann nicht? Wie sieht es mit Impulskontrolle aus? Diese Infos sind Gold wert für eine vernünftige Diagnostik. Und such dir einen Facharzt – Psychiater oder psychologische Psychotherapeuten haben einfach mehr Zeit und Spezialwissen als der gestresste Hausarzt mit fünfzehn Minuten pro Patient.
Angststörungen: Wenn dein Herz Alarm schlägt (aber vielleicht nicht dein Herz)
Herzrasen. Brustschmerzen. Schweißausbrüche. Atemnot. Todesangst. Du landest in der Notaufnahme, fest überzeugt, dass das dein letzter Tag auf Erden ist. Nach allen Tests sagt dir jemand im weißen Kittel: „Ihr Herz ist völlig gesund. Das war eine Panikattacke.“
Angststörungen sind körperliche und psychische Achterbahnfahrten gleichzeitig, und genau das macht sie zu diagnostischen Chamäleons. Sie gehören zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt und zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen. Aber weil Panikattacken sich anfühlen wie ein verdammter Herzinfarkt, landen Betroffene erstmal in der Kardiologie.
Die Verwechslung funktioniert aber auch andersrum. Manchmal werden echte körperliche Probleme vorschnell als „Angst“ abgestempelt, besonders wenn die erste Runde Tests nichts Eindeutiges zeigt. Unklare Herzbeschwerden? „Das ist bestimmt psychisch.“ Magen-Darm-Probleme ohne klare Ursache? „Wahrscheinlich Stress und Angst.“
Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen mit Angststörungen deutlich mehr medizinische Untersuchungen durchlaufen, bevor die richtige Diagnose steht. Umgekehrt bekommen Menschen mit seltenen körperlichen Erkrankungen nicht selten erstmal das Etikett „Angstpatient“ verpasst. Es ist ein diagnostisches Ping-Pong-Spiel, bei dem am Ende alle frustriert sind.
Der Schlüssel: Gründlichkeit in beide Richtungen
Körperliche Ursachen müssen vernünftig ausgeschlossen werden. Aber gleichzeitig sollte man Angststörungen als das ernst nehmen, was sie sind: echte, behandelbare Erkrankungen. Nicht „eingebildete“ Probleme von „Hypochondern“. Angststörungen sind so real wie ein gebrochener Arm – nur dass man den Bruch nicht auf dem Röntgenbild sieht.
Somatoforme Störungen: Der diagnostische Joker (und warum das problematisch ist)
Und hier haben wir den absoluten Champion der Verwirrung. Somatoforme Störungen – heute oft „somatische Belastungsstörungen“ genannt – gehören zu den am häufigsten vergebenen Diagnosen überhaupt. Gleichzeitig sind sie die problematischsten. Die Idee dahinter ist eigentlich sinnvoll: Es gibt reale körperliche Symptome, für die sich keine organische Ursache finden lässt, und die Psyche spielt eine zentrale Rolle.
Aber hier liegt auch ein riesiges Minenfeld. Bei seltenen körperlichen Erkrankungen bekommen rund 40 Prozent der Betroffenen zunächst eine Fehldiagnose – und sehr häufig stammt diese aus dem psychosomatischen Formenkreis. Die Logik ist bestechend einfach und gleichzeitig brandgefährlich: „Wir finden nichts, also muss es psychisch sein.“
Besonders betroffen sind Frauen. Studien dokumentieren eine systematische Tendenz, diffuse oder schwer erklärbare Symptome bei Frauen schneller als „psychosomatisch“ einzuordnen als bei Männern mit identischen Beschwerden. Das ist kein böser Wille einzelner Ärzte, sondern ein strukturelles Problem, das auf tief sitzenden Geschlechterstereotypen beruht. Und es kann lebensgefährlich werden, wenn dadurch echte Erkrankungen übersehen werden.
Gleichzeitig werden Menschen mit echten somatoformen Störungen oft nicht ernst genommen. Sie hören „Das ist alles nur psychisch“ in einem Ton, der impliziert: „Sie spinnen.“ Was völlig falsch ist. Somatoforme Störungen sind real, die Symptome sind real, die Belastung ist real. Sie brauchen eine angemessene Behandlung, keine Stigmatisierung.
Das Doppelproblem
Untersuchungen zeigen, dass die Übereinstimmung zwischen der ersten Diagnose vom Hausarzt und späteren Fachdiagnosen gerade bei somatoformen Störungen besonders gering ist. Das bedeutet: Was zunächst als psychosomatisch eingeordnet wird, stellt sich bei genauerer Untersuchung häufig als etwas ganz anderes heraus – in beide Richtungen. Manchmal ist es doch eine körperliche Erkrankung, manchmal eine andere psychische Störung, manchmal tatsächlich eine somatoforme Störung. Aber die erste Einschätzung ist oft voreilig.
Warum passiert das überhaupt? Die Psychologie hinter dem diagnostischen Chaos
Jetzt wird es meta: Warum verwechseln selbst gut ausgebildete Fachleute diese Störungen so regelmäßig? Die Antwort liegt in der Natur psychischer Diagnosen selbst – und in ein paar fiesen kognitiven Fallen, in die auch Profis tappen.
Erstens: Symptomüberlappung. Psychische Störungen teilen sich eine begrenzte Anzahl von Kernsymptomen. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung, Stimmungsschwankungen – diese Beschwerden tauchen bei Depressionen auf, bei Angststörungen, bei ADHS, bei bipolaren Störungen und auch bei diversen körperlichen Erkrankungen. Die Diagnosemanuale wie ICD oder DSM verlangen aber scharfe Kategorien mit klaren Grenzen. Das ist in der Theorie praktisch, in der Realität aber oft Wunschdenken.
Zweitens: Kognitive Verzerrungen. Ärzte sind Menschen, und Menschen denken in Abkürzungen. Die Verfügbarkeitsheuristik sorgt dafür, dass Diagnosen, die man gerade häufig sieht, einem schneller in den Sinn kommen. Wenn in deiner Praxis gerade eine Welle von Burnout-Patienten durchgelaufen ist, wirst du beim nächsten Patienten mit Erschöpfungssymptomen unbewusst in die gleiche Richtung denken. Der Bestätigungsfehler führt dann dazu, dass man vor allem die Informationen wahrnimmt, die zur ersten Vermutung passen – und Hinweise auf was anderes übersieht.
Drittens: Stigma und Psychologisierung. Es gibt eine kulturelle Tendenz, körperlich unerklärbare Beschwerden als „psychisch“ zu interpretieren. Das passiert besonders schnell bei Frauen, bei jungen Menschen oder bei Menschen, die bereits eine psychische Diagnose in ihrer Akte haben. Umgekehrt zögern viele Betroffene, psychische Diagnosen anzunehmen, weil sie als Schwäche verstanden werden. Das führt dazu, dass sie spät und oft schon mit verzerrten Selbstberichten in die Versorgung kommen.
Was du selbst tun kannst (ohne komplett durchzudrehen)
Nach all diesen Horrorgeschichten fragst du dich vielleicht: Kann ich meiner eigenen Diagnose überhaupt noch trauen? Die ehrliche Antwort: Meistens ja, aber gesunde Skepsis ist nicht nur erlaubt, sondern manchmal geboten.
Wenn eine Behandlung über Monate nicht anschlägt, wenn du das Gefühl hast, dass in der Erklärung etwas fehlt, oder wenn wichtige Symptome einfach abgetan wurden, dann ist das ein verdammt guter Grund für eine zweite Meinung. Wirklich gute Fachleute werden das nicht als Beleidigung verstehen, sondern als Teil eines sorgfältigen diagnostischen Prozesses.
Ein paar praktische Schritte:
- Führe ein Symptomtagebuch – und zwar nicht nur über die schlechten Zeiten. Notiere auch ungewöhnliche Phasen mit viel Energie, wenig Schlafbedarf oder impulsivem Verhalten. Diese Informationen sind Gold wert.
- Bestehe auf körperliche Abklärung. Bevor eine psychische Diagnose feststeht, sollten zumindest die wichtigsten organischen Ursachen ausgeschlossen sein: Schilddrüse, Vitamine, Eisen, bei Bedarf auch Herzuntersuchungen.
- Suche Fachärzte auf. Hausärzte leisten Großartiges, aber für komplexe psychische Diagnosen sind Psychiater oder psychologische Psychotherapeuten die erste Adresse. Sie haben mehr Zeit und Spezialwissen.
- Trau dich, Widersprüche anzusprechen. Wenn deine Symptome nicht zu passen scheinen oder wenn etwas in der Erklärung unstimmig ist, sag es. Eine gute Diagnostik lebt vom Dialog.
Die wichtigste Erkenntnis aus diesem diagnostischen Dschungel ist vielleicht diese: Psychische Diagnosen sind keine in Stein gemeißelten Wahrheiten. Sie sind Arbeitshypothesen, die helfen sollen, eine passende Behandlung zu finden. Manchmal stimmt die erste Hypothese, manchmal muss sie angepasst werden, und manchmal stellt sich heraus, dass man von Anfang an auf der falschen Fährte war.
Das ist nicht per se schlimm und auch kein Zeichen für schlechte Medizin. Es ist die Realität einer Wissenschaft, die es mit einem der komplexesten Organe des Universums zu tun hat: dem menschlichen Gehirn. Was zählt, ist die Bereitschaft, genau hinzuschauen, Diagnosen zu hinterfragen, wenn sie nicht passen, und als Patient mit dem ernst genommen zu werden, was man erlebt.
Die Daten aus der deutschen Versorgungsforschung zeigen, dass psychische Störungen einerseits häufig diagnostiziert werden – aber gleichzeitig auch übersehen oder falsch eingeordnet werden können. Das ist kein Widerspruch, sondern zwei Seiten derselben Medaille: einer Diagnostik, die mit unscharfen Grenzen, überlappenden Symptomen und der ganzen Komplexität menschlichen Erlebens umgehen muss.
Also: Wenn deine Diagnose sich stimmig anfühlt und die Behandlung hilft – großartig. Wenn nicht, ist das kein Grund zur Resignation, sondern ein Signal, weiter nach Antworten zu suchen. Du kennst dich selbst am besten. Die Kunst liegt darin, dieses Selbstwissen mit professioneller Expertise zu verbinden – und notfalls hartnäckig zu bleiben, bis die Puzzleteile zusammenpassen. Dein Gehirn ist es wert.
Inhaltsverzeichnis